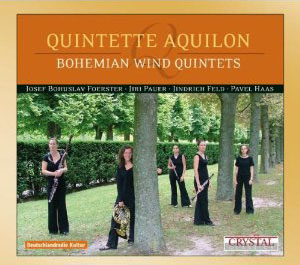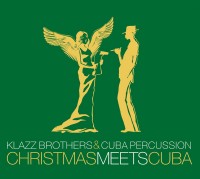Die dominierenden Komponisten der tschechischen Musikvergangenheit – Bedřich Smetana, Antonín Dvořák und Leoš Janácek – sind im Bewusstsein des Klassikhörers fest verankert.
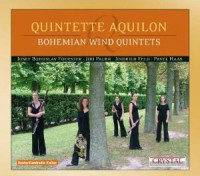
Weniger bekannt ist hingegen, dass der böhmisch-mährische Kulturraum auch nach diesen zentralen Figuren noch so manche Ausnahmebegabung hervorgebracht hat.
Einige dieser gut gehüteten Geheimnisse enthüllt das Quintette Aquilon, benannt nach dem römischen Gott der Winde, auf seinem jüngsten Album „Bohemian Wind Quintets“.
Mit dem 1961 entstandenen Bläserquintett von Jiří Pauer (1919 – 2007) zum Beispiel hat das reine Frauenensemble aus Frankreich eine wunderbare Rarität einstudiert.
Der Komponist aus dem zentralböhmischen Libušín war nach dem II. Weltkrieg ein strenger Verfechter des sozialistischen Realismus, was ihn freilich nicht daran hinderte, in seinem Œuvre ein naiv-heiteres Weltbild zu verbreiten.
Sein Bläserquintett macht da keine Ausnahme, es pendelt stimmungsmäßig zwischen spielerischer Ausgelassenheit und Karnevalsstimmung.
Pavel Haas (1899 – 1944) aus Tschechiens zweitgrößter Stadt Brno (Brünn) komponierte sein op. 10 für das seinerzeit neu gegründete Mährische Bläserquintett.
Das suitenartige Stück des Janácek-Schülers ist geprägt von einer farbenreichen Harmonik sowie vier im Klangcharakter unterschiedlich angelegten Sätzen.
Als jüdischer Komponist wurde Haas wie viele seiner Zeitgenossen während der Besatzung der deutschen Truppen zunächst nach Theresienstadt deportiert und 1944 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.
Als Alexander Dubcek 1968 mit seinen Reformbestrebungen den Prager Frühling ausrief und die Tschechoslowakei somit der Welt ringsherum öffnete, schrieb Jindřich Feld (1925 – 2007) sein zweites Bläserquintett, das deutlich vom Einfluss westlicher Komponisten der Moderne geprägt ist.
In dem tonal freien Werk zeigt sich Felds ausgeprägter Sinn für Formgebung nach dem Vorbild der Zweiten Wiener Schule um Arnold Schönberg.
Josef Bohuslav Foerster (1859 – 1951) schließlich verfasste sein Bläserquintett in D-Dur im Jahre 1909 auf Anregung eines Klarinettisten der Wiener Philharmoniker. Bei seinem op. 95 reizte ihn „das
Ungewohnte der verschiedenen Instrumentalfarben“, wie er in den Memoiren notierte. Das Werk steht in der spätromantischen Tradition und stellt heute die meistgespielte Arbeit Foersters überhaupt dar.
Die intelligenten Interpretationen der höchst unterschiedlichen Kompositionen beweisen einmal mehr die Vielseitigkeit des Quintette Aquilon. Nicht zuletzt der verdanken Sabine Raynaud (Querflöte), Gaëlle Habert (Fagott), Marianne Tilquin (Waldhorn), Claire Sirjacobs (Oboe) und Stéphanie Corre (Klarinette) ihren hervorragenden Ruf in der aktuellen Klassikszene.
Zahlreiche Auszeichnungen (unter anderem beim Wettbewerb Henri Tomasi in Marseille, beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb in München und dem Ensemble-Wettbewerb FNAPEC in Paris) unterstreichen ebenfalls die Topstellung des Quintetts.
In der internationalen Konzertlandschaft und auf Festivals wie dem Jeunes Talents, Les Folles Journées, dem Rheingau Festival und dem Festival Mecklenburg-Vorpommern sind die Französinnen gern gesehene Gäste.